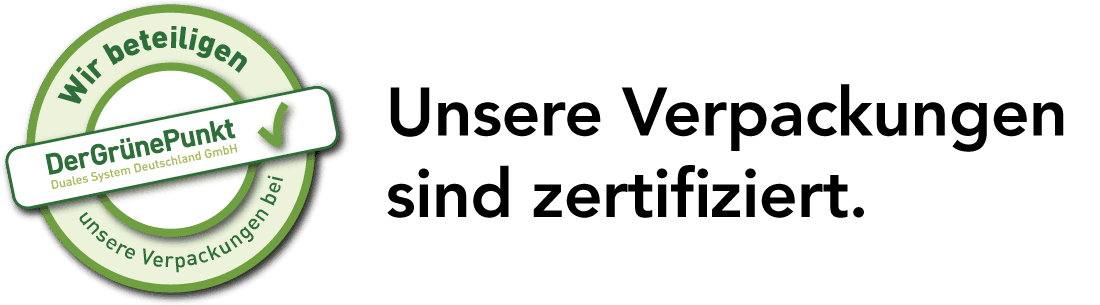von Dr. med. Konstantin Wagner
23.10.2024
Harninkontinenz – Was ist das?
Definition Harninkontinenz nach der International Continence Society (ICS) = jeglicher unfreiwilliger Urinabgang
- Sehr häufiges, meist unterdiagnostiziertes Krankheitsbild von Frauen aller Altersklassen
- Hoher Leidensdruck, da erhebliche Einschränkungen im Alltag und der Lebensqualität
Welche Formen der Harninkontinenz gibt es?
Belastungsinkontinenz (früher Stressinkontinenz), ca. 50 % = unwillkürlicher Urinverlust bei körperlicher Anstrengung (z. B. Husten, Niesen, Sport) ohne Harndrang. Dranginkontinenz (früher Urgencyinkontinenz), ca. 15 % = unwillkürlicher Urinverlust, der von imperativem Harndrang begleitet ist oder diesem folgt. Er kann mit oder ohne eine Detrusorhyperaktivität auftreten.Mischharninkontinenz, ca. 30 % = beinhaltet Symptome sowohl der Belastungs- als auch der Dranginkontinenz.

Wie häufig kommt das vor?
- Prävalenz in der internationalen Literatur 18,6 - 60 %, BREST-Studie 21,2 %, erhebliche Dunkelziffer!
- Kann in jedem Lebensalter auftreten, Prävalenz und Ausmaß nehmen mit dem Alter zu.
- Jede 3. Mutter leidet nach Geburt an BB-Problemen, jede 5. ist inkontinent und verliert ungewollt Urin.
- Risiko nach Geburt inkontinent zu sein, ist etwa 3 x so hoch, wenn bereits während SS inkontinent.
Prävalenz in SS: .
- Nimmt im Laufe einer SS stetig zu.
- 1. Trimenon 8-10 %.
- 2. Trimenon 23-32 %.
- Am ET 15-35 %.
- Norwegische Prävalenzstudie: HIK-Rate 58 % bei Frauen in der 31. SSW, 40 % unter Erstgebärenden.
- Persistenz Inkontinenz über 12 Jahre nach Geburt 24-37,9 %.
- Häufigkeit nach Geburtsmodus: Spontanpartus (25,6 %) > assistierte, instrumentelle Geburt (20,8 %) > Sectio (10,3 %).
- Postpartale Urininkontinenz nimmt über die Jahre nach Geburt sogar noch zu

Warum kommt es nach Schwangerschaft und Geburt zu einer Harninkontinenz?
- Massive Dehnung der muskulären und bindegewebigen Strukturen des Beckenbodens während der vaginalen Entbindung (vorbereitet durch komplexe biochemische Veränderungen) führen zu Mikro- und Makrotraumen und einer Hypermobilität das Blasenhalses post partum
- Hypermobilität lässt sich nur bedingt über die Muskulatur kompensieren, das begrenzt den Nutzen einer Physiotherapie und/oder Rückbildungsgymnastik
- Neuere Arbeiten zeigen zudem, dass sich die Muskulatur des Beckenbodens längst nicht so rasch erholt und zu alter Stärke zurückfindet, wie gemeinhin angenommen (im Gegensatz zum Uterus, der sich innerhalb von 6 Wochen von 1000 g auf 50 g zurückbildet oder der Wundheilung von DR I-II, deren Heilung nach 4-6 Wochen abgeschlossen sein kann)
- Außerdem ist nicht nur Muskulatur betroffen, sondern auch Bindegewebe, das nicht „beübt“, sondern nur entlastet werden kann
- Gilt auch für überdehnte Äste des Nervus pudendus = bedeutendster Nerv für Sensibilität und Motorik des Beckenbodens
Was sind die Risikofaktoren?
Allgemeine Risikofaktoren:
- Nikotinabusus
- Adipositas (BMI > 25 kg/m2)
- Chronische Obstipation
- Bewegungsmangel
- Regelmäßige Einnahme von koffeinhaltigen und kohlesäurehaltigen Getränken
- Neurologische Erkrankungen (z. B. MS, Parkinson, Querschnittslähmung)
- Diuretikaeinnahme
- Strahlentherapie
- Familiäre Prädisposition
Geburtshilfliche Risikofaktoren
- Frauen, die bereits in der Schwangerschaft eine Harninkontinenz aufweisen
- Höheres Alter bei er ersten Geburt > 35 Jahre
- Familiäre Disposition mit Geburtsgewicht > 4000g
- Lange Austreibungsperiode von 2 bis 3 Stunden
Welche Therapiemöglichkeiten gibt es?
Bist du von Beckenbodenproblemen und/oder Inkontinenz betroffen ist die richtige Anlaufstelle in jedem Fall deine Frauenärzt*in. Falls sie selbst deine Beschwerden nicht ernst nimmt oder am Ende ihres Lateins angekommen ist, kann eine Überweisung in ein Beckenboden-Zentrum in deiner Nähe, die sich auf Beschwerden rund um den Beckenboden spezialisiert haben, sinnvoll sein.
Grundsätzlich sollten alle postpartalen Beckenbodenfunktionsstörungen zunächst konservativ behandelt werden und wie so häufig in der Medizin sollte die Behandlung nach Schweregrad und in verschiedenen Stufen erfolgen. Auch eine Kombination aus verschiedenen Maßnahmen, wie beispielsweise ein Pessar und Physiotherapie kann sinnvoll sein.
Allgemeine Maßnahmen
- Regelmäßiges Wasserlassen
- Keine erhöhte Flüssigkeitsaufnahme
- Stuhlregulierung bei chronischer Verstopfung
- Schwere körperliche Arbeit vermeiden
- Regelmäßige körperliche Aktivität
- Gewichtsabnahme bei Übergewicht
- Beendigung Rauchen
- Koffeinverminderung
- Gesunde Ernährung
Hilfsmittel
Training des Beckenbodens mit Hilfe von:
- Rückbildungsgymnastik
- Physiotherapie durch speziell geschulte Beckenboden-Therapeut*innen
Medikamentöse Therapie
- Anwendung bei überaktiver Blase, Dranginkontinenz oder Mischharninkontinenz
- Anwendung nach gescheiterter konservativer nicht-medikamentöser Therapie
- Antimuskarinika: Trospium, Tolterodin, Solifenacin, Propiverin, Oxybutinin (orale Anwendung nicht empfohlen), Fesoterodin, Darifencacin
- ß3-Adrenorezeptor-Agonist: Mirabegron
- Duloxetin bei Belatungs- und Mischharninkontinenz
Pessartherapie
- Pessare bestehen aus Silikon und sind in verschiedenen Formen erhältlich
- Werden von der Patient*in selbst eingesetzt, entfernt und gereinigt
- Durch Positionierung im Vaginalbereich wird der Blasenhals durch sanften Druck in seine Ursprungsposition zurückgeführt.
- Geduld und Erfahrung bei der Auswahl und Anpassung des richtigen Pessars sind nötig
- Auf ausreichende lokale Östrogenisierung (Östriol lokal) achten
Operative Therapie
- Sehr zurückhaltende Indikationsstellung in den ersten 12 Monaten nach Geburt
- Erst nach abgeschlossener Familienplanung
- Beispiele für Operationen bei Belastungsinkontinenz: Kolposuspension, spannungsfreies transurethrales Band
Beckenboden-REhabilitations-STudie (BREST) (veröffentlicht 11/2021)
- 491 Patient*innen aus 6 Frauenarztpraxen
- Jede 10. Patient*in wünschte Therapie
- Randomisierte Zuweisung in 3 Therapiearme: Rückbildungsgymnastik, BB-Gymnastik durch Physiotherapeut*in, Pessartherapie
- Ergebnisse: 85 % zufrieden mit Pessartherapie, 31 % mit Physiotherapie, 38 % mit Rückbildungsgymnastik
- Schlechtes Abschneiden Physio vermutlich in Zusammenhang mit Corona-Pandemie, dennoch zeigt Studie wie effektiv Pessartherapie sein kann

Fazit:
- Ursache der Inkontinenz ist meist eine Hypermobilität des Blasenhalses, die durch Physiotherapie und Rückbildungskurse nur bedingt kompensierbar ist. Therapie der Wahl sollte daher die Suspension des Blasenhalses durch ein Pessar sein.
- In Deutschland nur vollkommen unzureichend eingesetzt.
- Intensivierung der Facharztweiterbildung ist dringend notwendig.
Quellen:
Dr. med. Konstantin Wagner
Hallo, ich heiße Konstantin und bin Facharzt für Gynäkologie und Geburtsmedizin. Nach meinem Medizinstudium in München habe ich von 2015 bis 2020 in einer maximalversorgenden Klinik in Kassel gearbeitet. Dort hatte ich es mit unzähligen spannenden Fällen zu tun, betreute hunderte Geburten und sammelte einen großen medizinischen Erfahrungsschatz. Seit 2020 widme ich mich der niedergelassenen Tätigkeit in meiner eigenen gynäkologischen Praxis in Kassel.
Im Kontakt mit meinen Patientinnen wurde mir bewusst, wie schwer es medizinischen Laien oft fällt, echte Fachinformationen von Mythen und Internet-Panikmache zu unterscheiden. Ich habe es mir daher zur Aufgabe gemacht, fundiertes Wissen zu meinen Fachgebieten zur Verfügung zu stellen – in verschiedensten Formaten sowie auf nachvollziehbare und kurzweilige Weise.